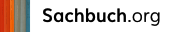Affektheuristik - Fehlurteile vermeiden

Der Nobelpreisträger Daniel Kahneman hat in seinem Weltbestseller "Schnelles Denken, langsames Denken" verschiedene Effekte erörtert, die unsere Urteils- und Entscheidungsfähigkeit negativ beeinflussen können.
Dazu gehört die sog. Affektheuristik.
Selbstreflektion zur Einstimmung ins Thema:
- Wie stehen Sie zur Migrationspolitik der Bundesregierung grundsätzlich? Befürworten Sie eine weitgehende Öffnung unserer Grenzen gegenüber Zuwanderern? Falls ja: Denken Sie, dass damit eher ein hoher Nutzen verbunden ist und die Kosten beherrschbar sind oder umgekehrt?
- Fällt es Ihnen schwer, ein Projekt zu beenden, das Sie „als Ihr Baby“ initiiert, d.h. zu dem Sie eine hoch emotionale Beziehung haben, selbst wenn offensichtlich ist, dass die Bedingungen sich so verändert haben, dass ein Weiterführen unter dem Strich zu immer weiteren Verlusten führen würde?
Sind Ihnen bei einer positiven Grundeinstellung zur Migration eher Argumente für einen hohen Nutzen eingefallen und die Kosten eher als beherrschbar erschienen und umgekehrt bei einer eher negativen Grundeinstellung vor allem Argumente, die den Nutzen gering und die Kosten hoch erscheinen lassen, liegt dies ggf. an der Affektheuristik.
Die Grundeinstellung zur Migration kann Ihr Urteilsvermögen einseitig beeinflussen.
Nach Kahnemann bestimmt die emotionale Einstellung zu einem Thema die Ansichten über Nutzen und Risiken, die mit dem Thema verbunden sind.
Existieren emotionale Einstellungen werden vor allem solche Informationen gesucht, die bestehende Überzeugungen bestätigen.
Beispiel: Raucher betonen vor allem Argumente, die die Risiken gering einschätzen und statistisch wenig aussagekräftig sind („Mein Opa war starker Raucher und wurde 100Jahre alt“).
Die Affektheuristik kann zu Fehlurteilen führen, wenn einseitige, unausgewogene Argumente zur Begründung von Einstellungen bzw. Entscheidungen herangezogen werden. Sie führen dann zu unrealistischen Einschätzungen.
Die Affektheuristik beschreibt einen Prozess, der häufig unbewusst stattfindet und von früheren Erfahrungen abhängig ist.
Beispiel: Wenn Sie beim Wandern in den Bergen vor kurzem einen schmerzhaften Unfall erlitten haben, werden Sie bei der nächsten Tour ggf. übervorsichtig sein und mögliche Unfallrisiken überschätzen.
Wir sind aufgrund der Affektheuristik oftmals weit davon entfernt, vernünftig unter ausgewogener Abwägung von Vor- und Nachteilen zu entscheiden. So neigen Führungskräfte dazu, in Krisenzeiten auf Strategien zurückzugreifen, die früher zu Erfolgen geführt haben, obwohl veränderte Rahmenbedingungen jetzt Entscheidungen für neue Strategien erfordern würden. Risiken, die gegen die Weiterführung der Strategien sprechen, werden unterdrückt.
Die Affektheuristik wirkt sich besonders negativ aus, wenn
- bestehende Vorurteile gegenüber neuen Technologien (z.B. Elektromobilität) dazu führen, dass Chancen und Risiken unrealistisch wahrgenommen und damit zu spät auf Herausforderungen reagiert wird (Risiken der Dieseltechnologie zu lange ignoriert werden). Die Folgen können die gesamte Automobilwirtschaft gefährden.
- die Politik Prioritäten aufgrund von öffentlichem Druck einzelner ideologisch geprägter Interessengruppen setzt, statt auf Basis einer objektiven Analyse, politische Entscheidungen sich am Mainstream orientieren (z.B. zum Klimaschutz) ohne, dass in einem offenen rationalen Diskurs Chancen und Risiken abgewogen werden. „Was wäre, wenn die Klimaschutzpolitik die falschen Prioritäten setzen würde?“
- generell Entscheidungen in Institutionen nicht kritisch hinterfragt werden können bzw. tabuisiert sind (autoritäre traditionelle Führungskulturen)
Wie relevant ist der Faktor für Sie? In welchen Situationen sehen Sie Handlungsbedarf?
Wie können Sie Fehlurteile aufgrund der Affektheuristik vermeiden?
- Machen Sie sich die Gefahr von Fehlurteilen aufgrund der Affektheuristik bewusst: Wie realistisch sind Ihre Nutzen- und Risikoeinschätzungen? Welche Kosten könnten mit Fehlentscheidungen verbunden sein? Hinterfragen Sie Entscheidungen kritisch hinsichtlich der damit verbundenen Bewertungen z.B. von Nutzen und Risiken.
- Seien Sie offen für unterschiedliche Informationen. Beziehen Sie sich auf unabhängige Quellen.
- Akzeptieren Sie überzeugende Gegenargumente. Stichhaltige Informationen sollten nach Möglichkeit statistisch durch eine ausreichend große Stichprobe belegt sein.
- Vertreten Sie als Advocatus Diaboli die rhetorische Strategie eines Anwalts, der zunächst ganz bewusst die Position seines Gegners einnimmt, bevor er die eigene Sichtweise begründet.
- Seien Sie kritisch, wenn es einen übertriebenen Optimismus oder ein übertriebenes Harmoniebedürfnis vor Entscheidungen gibt, wenn nahezu ausschließlich Vor- oder Nachteile einer Sache angesprochen werden. Beliebte Vorschläge, die dem Mainstream entsprechen, können leicht dazu führen, dass Gegenargumente nicht diskutiert werden, z.B. wenn es bekannt ist, dass es sich um ein Lieblingsthema vom CEO handelt. Fragen Sie nach, ob es auch abweichende Meinungen gibt.
- Vermeiden Sie Trendextrapolationen, die eine reine statistische Fortschreibung von Vergangenheitswerten darstellen, die nicht hinterfragt werden. Prüfen Sie, ob die Bedingungen, die in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben, auch zukünftig noch gelten.
- Spielen Sie positive und negative Szenarien durch. Erarbeiten Sie eine detaillierte Risikoanalyse bei positiven Entscheidungen.
- Entscheidungen über Maßnahmen sollten einer objektiven, rationalen Kosten-Nutzen-Einschätzung folgen, Expertenwissen integrieren und nach gründlicher Diskussion unter Abwägung aller Pro- und Contra-Argumente erfolgen.
- Fördern Sie „lernende Organisationen“ mit einer Kultur der Offenheit und Transparenz, die einen rationalen Diskurs fördert.
© Prof.Dr.Merk
Quelle
Kontakt: merk@t-pu.de