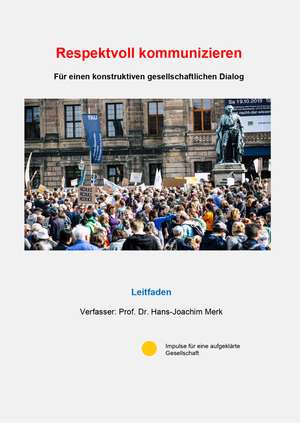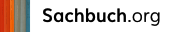Checkliste: Verhaltenscodex speziell im Umgang mit "Verschwörungstheorien"
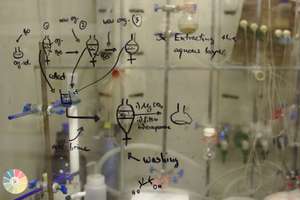
„Wurde das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan gezielt auf die Menschheit losgelassen? Ist das Virus eine Biowaffe? Drohen uns in kürzester Zeit Millionen Tote, wenn wir nicht schnell zu radikalen Maßnahmen greifen? Wussten Behörden, andere Organisationen oder Bill Gates schon vorher von diesem Coronavirus? Nimmt die ‚Bill und Melinda-Gates-Stiftung‘ aus Eigeninteresse Einfluss auf die Empfehlungen der WHO?“
Über sogenannte Verschwörungstheorien wird regelmäßig in öffentlichen und privaten Medien insbesondere in Krisenzeiten berichtet. Menschen sind für Verschwörungstheorien mit einfachen Erklärungen in Zeiten besonders anfällig, in denen sie sich von äußeren Ereignissen bedroht fühlen, die Ursachen für die Krise nicht durchschauen und keine Kontrolle über die Situation haben.
Warum ist dieses Thema wichtig?
- Verschwörungstheorien können durch Desinformation ein Klima der Angst und Radikalisierung in einer verunsicherten Bevölkerung erzeugen bzw. verstärken. Verschwörungstheorien dienen oftmals dem Zweck, die öffentliche Meinung durch überzogene Dramatisierung zu manipulieren und das Verhalten in eine von Propagandisten erwünschte Richtung zu steuern. Angst ist ein schlechter Ratgeber, wie ein Sprichwort sagt. Menschen sollen dazu verleitet werden, unter Zeitdruck autoritäre Entscheidungen unreflektiert zu akzeptieren, die sie unter normalen Umständen nach ausführlicher Abwägung nicht befürwortet hätten. Öffentliche Kritik, der man sachlich nicht begegnen könnte, soll unterbunden werden.
- Der Begriff „Verschwörungstheorie“ wird in der öffentlichen, speziell politischen Diskussion inflationär als Kampfbegriff („Killerphrase“) häufig missbräuchlich - ohne Belege anzuführen - verwendet, um unliebsame Meinungen ohne Diskussion zu unterbinden.
Eine aufgeklärte Gesellschaft mündiger Bürger darf nicht zum Spielball von Verschwörungstheoretikern werden.
Mündige Bürger sollten Verschwörungstheorien kritisch hinterfragen und sich damit vor Manipulationen schützen. Dieser Gefahr der Manipulation möchte ich entgegenwirken und – selbst in Krisenzeiten – für mehr kritische Reflektion ohne künstlich herbeigeführten Zeitdruck werben. Aussagen über Ereignisse, die im Verdacht stehen, als Verschwörungstheorien zu gelten, sollten kritisch bewertet werden, angeführte Behauptungen mit Faktenwissen konfrontiert und begründet widerlegt werden, um diesen damit den Nährboden für Manipulationen zu entziehen.
Nachstehend finden Sie ausgewählte Verhaltensregeln, die Diskutanten auszeichnen, die sachlich überzeugend argumentieren und jeden Anschein vermeiden wollen, dass es sich bei Ihren Aussagen um Verschwörungstheorien oder populistische Aussagen handeln könnte.
Checkliste: Verhaltenscodex speziell im Umgang mit „Verschwörungstheorien“
Diskutanten zeichnen sich im Umgang mit Verschwörungstheorien positiv aus, wenn sie...
- ...Meinungs-/ Konfliktgegner differenziert beurteilen, statt stereotype negative Zuschreibungen (z.B. "Rechte" oder "Linke") zu verwenden und Meinungsgegner auf wenige Eigenschaften einseitig zu reduzieren
- ...auch die eigene Mitverantwortung an den beklagten Zuständen einräumen, statt einseitiger Schuldzuweisungen ("Die Chinesen sind alleine Schuld...")
- ...eine breite inhaltliche Abstimmung über die Hintergründe von Konflikten und den Einsatz notwendiger Maßnahmen herbeiführen, statt die Gemeinschaft/ Dritte über Feindbilder zu solidarischem Handeln zu bewegen
- ...ein umfassendes Bild der relevanten Ursachen vermitteln, das durch unabhängige Experten und wissenschaftliche Analysen repräsentativ gestützt wird, statt monokausaler Erlärungen
- ...auch alternative Meinungen auf ihren Wahrheitsgehalt und ihre Relevanz hin ergebnisoffen bewerten, statt Aussagen gegenüber Kritik abzuschotten (immunisieren) und als alternativlos autoritär durchzusetzen
- ...sich auf unabhängige Informationsquellen beziehen, die nicht im Verdacht stehen als „Tendenzbetriebe“ Partikularinteressen zu dienen, sondern ausgewogen und neutral berichten, statt unzulässiger Vereinfachungen und Verfälschungen von Tatsachen
- ...Fehlurteile vermeiden, statt in Scheinkorrelationen fälschlicherweise kausale Beziehungen hineinzuinterpretieren, die als Nachweis für eigene Erfolge ausgegeben werden und/ oder die wahren Ursachen von Ereignissen durch Desinformationskampagnen bewusst verschweigen
- ...die Legalität der geplanten Maßnahmen und die Legitimität umfassend nach Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit unter Einbindung aller relevanten Gruppen (Stakeholder) prüfen, statt illegal und/ oder illegitim zu handeln
- ...über die Auswirkungen von Krisen sachlich unter Abwägung aller negativen und ggf. auch positiven Folgen aufklären, statt durch Dramatisierungen ein Klima der Angst zu erzeugen und Unsicherheit zu verstärken
- ...einen offenen sachlichen Diskurs auf Augenhöhe auch mit gegnerischen Parteien führen, statt Meinungsgegner mit Kampfbegriffen pauschal zu diffamieren und einen Dialog abzulehnen
- ...die eigenen Interessen transparent machen und neutralen Dritten einen unverfälschten Einblick gewähren, statt die Hintergründe für die eigenen Positionen (konspirativ) im Vorborgenen zu halten
- ...die für alternative Argumente (und Experten) aufgeschlossen sind, statt die eigenen Positionen dogmatisch als quasi unumstößliche Wahrheiten gegen Kritik zu immunisieren
- ...generell auf populistische Aussagen verzichten und in einem offenen Dialog Meinungsgegnern Gelegenheit bieten, Vorurteile zu entkräften, statt durch populistische Aussagen Krisen heraufzubeschwören