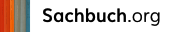Sachgerecht und fair Verhandeln: 6. Phase 4: Objektive Kriterien vereinbaren und Optionen ableiten

„Man kann Probleme nicht mit dem gleichen
Denkansatz lösen, der sie geschaffen hat.“
(Albert Einstein)
In Phase 4 geht es darum, zu überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten zur Verwirklichung der verschiedenen Interessen in Betracht kommen.
Alle grundsätzlich attraktiven Einigungsmöglichkeiten sollen erörtert werden. Ziel ist die Erweiterung der Wahlmöglichkeiten, um eine breite Basis für die Auswahl der bestmöglichen Konfliktlösung zu erhalten.
Wir erreichen damit, dass jede Partei sich nicht nur mit den eigenen Interessen beschäftigt, sondern auch die Interessen der anderen Seite bei der Lösungsfindung berücksichtigt.
Begrüßung und Rückblick auf Phase 3
Beispiel für die Anmoderation:
„Wir haben bisher die bestehenden Differenzen umfassend geklärt, sowohl
was den Sachverhalt als auch was die damit verbundenen Interessen bzw.
Anliegen angeht.
In Phase 4 suchen wir nach Lösungen für die bestehenden Differenzen.
Wir überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten zur Verwirklichung der
verschiedenen Interessen in Betracht kommen.
In Konflikten sind die Parteien regelmäßig in einem
„Nullsummenparadigma“ gefangen. Erhält die Gegenseite einen Vorteil,
muss dies zwangsläufig zu einem Nachteil für uns werden, so denken wir.
Dabei gibt es vielfach Lösungen, die für alle Seiten Vorteile bieten.
Darum geht es in dieser Phase. Dabei sollen sowohl alle
Einigungsmöglichkeiten als auch die Alternativen zu einer Einigung erörtert
werden. Damit zielt der Schritt auf eine Erweiterung der
Wahlmöglichkeiten, um letztlich die relativ beste Lösung auswählen zu
können und vorschnelle Urteile zu vermeiden.
Damit erfüllen wir das dritte Grundprinzip der Harvard-Konzepts:
„Vor der Entscheidung sollten verschiedene Wahlmöglichkeiten entwickelt
werden!“
Gibt es Lösungsmöglichkeiten, die für alle Parteien akzeptabel sind? Wie
können wir diese herausfinden?
Wir gehen dafür in zwei Schritten vor:
- Zunächst werden Lösungsideen in einem kreativen Prozess
gesammelt.
- Danach werden sie auf ihre Eignung hin überprüft.“
Für ausgewählte Themen Lösungsideen sammeln
Beispiel für die Anmoderation:
„Ich schlage Ihnen vor, zunächst einmal alle für Sie denkbaren Lösungen zu
sammeln.
Äußern Sie alle denkbaren Lösungsansätze, die Ihnen zum ersten Thema,
das wir bereits in der letzten Phase angesehen haben, in den Sinn kommen.
Es können auch zunächst unrealistisch erscheinende Vorschläge sein. Die
Bewertung und Auswahl geeigneter Lösungsideen erfolgt dann in einem
späteren Arbeitsschritt.
Je mehr Wahlmöglichkeiten Sie in dieser Phase finden, umso leichter wird
Ihnen später der Einigungsprozess fallen.
Die Leitfrage lautet: Wie können wir erreichen, dass unser Konflikt zur
Zufriedenheit aller bestmöglich gelöst wird?
Wir werden jetzt zunächst Lösungsideen sammeln.“
Sammeln Sie anschließend im Rahmen Ihrer Moderation Lösungsideen.
Beispiel für die Anmoderation:
"Stellen Sie sich jetzt vor, der Konflikt wäre gelöst. Was wäre dann anders?
Was müsste geschehen, um dieses Ziel zu erreichen?
Lassen Sie uns möglichst viele Ideen sammeln für die Lösung unseres
Konflikts. Formulieren Sie alle Ideen, die Ihnen einfallen, ohne bereits jetzt
zu hinterfragen, unter welchen Voraussetzungen diese Ideen realisierbar
sind.
Bereiten Sie Ihre Vorschläge in gemischten Zweiergruppen vor. Jeweils ein
Vertreter einer Partei arbeitet mit einem Vertreter einer anderen Partei
zusammen.
Sie haben für Ihre Vorbereitung ca.10 Minuten Zeit.
Notieren Sie Ihre Lösungsideen auf Karten. Verwenden Sie für jede neue
Idee eine neue Karte. Schreiben Sie lesbar mit einem Filsstift. Sie werden
anschließend Ihre Ideen im Plenum vorstellen und mit wenigen Sätzen
begründen, warum diese Ideen attraktiv sein könnten.“
Hinweis: Überlassen Sie die Paarbildung den Parteien. Achten Sie lediglich darauf, dass es sich jeweils um gemischte Paare handelt.
Nach ca. 10 Minuten: Vorstellung der Ideen
Beispiel für die Anmoderation:
„Bitte stellen Sie Ihre Lösungsansätze vor. Erklären Sie kurz, was Sie unter
der Idee verstehen bzw. in welche Richtung die Idee zielt?
Warum könnten diese Ideen attraktiv für die Konfliktlösung aus Ihrer Sicht
sein?“
Hinweis: Begrenzen Sie die Liste der Vorschläge auf max. ein Dutzend.
Bitten Sie jedes Paar, zunächst nur den interessantesten Vorschlag zu
präsentieren. Um Wiederholungen auszuschließen, sollten die nachfolgenden Paare jeweils nur neue Ideen ergänzen. Fahren Sie ggf. in mehreren Runden solange fort, bis die interessantesten Vorschläge präsentiert wurden.
Wählen Sie eine erste Lösungsidee aus
Beispiel für die Anmoderation:
„Mit welcher Lösungsidee wollen Sie beginnen? Worüber wollen wir hier
sprechen? Worüber nicht?
Die Auswahl kann nach verschiedenen Kriterien erfolgen, z.B. nach
Dringlichkeit oder nach Eignung für die Erfüllung Ihrer Erwartungen oder
nach Umsetzbarkeit der Vorschläge etc.
Welche Anforderungen müssen gute Lösungen erfüllen?
Gibt es objektive Kriterien, die wir bei der Auswahl von Lösungen
zwingend beachten sollten?
Welche Verfahren führen zu einer fairen Bewertung? (z.B. „Verkehrswert“
als Grundlage für die Preisfindung beim Hausverkauf;
„Wiederbeschaffungskosten“ als Basis für die Berechnung des
Erstattungsbetrages von Versicherungen; gesetzliche Vorgaben oder
allgemeingültige Standards im Baurecht; wissenschaftliche Erkenntnisse zu
den Wirkungen einzelner Lösungsvorschläge; Expertenurteile z.B. zur
Wirtschaftlichkeit; Terminvorgaben etc.)
• Damit erfüllen wir das letzte Grundprinzip des Harvard-Konzepts:
„Das Ergebnis sollte auf objektiven Entscheidungskriterien
aufbauen!“
Lassen Sie uns – bevor wir zu den Lösungsideen kommen - zunächst
überlegen, welche objektiven Kriterien beachtet werden müssen, um zu
guten Entscheidungen zu kommen.“
Halten Sie die Kriterien auf einem Flipchart fest.
Diskutieren Sie die Kriterien und einigen Sie sich auf diejenigen, die die Parteien bei Ihrer Entscheidung mitberücksichtigen wollen.
Beispiel für die Anmoderation:
„Beurteilen Sie jetzt jeder für sich die Alternativen danach, inwieweit diese
geeignet sind, Ihre Interessen zu erfüllen unter Berücksichtigung der
abgeleiteten Kriterien. Es stehen Ihnen folgenden Kategorien zur
Verfügung. Bewerten Sie jeden Vorschlag mit einem + (für positiv), 0 (für
neutral) und - (für negativ). Kommen Sie möglichst alle gleichzeitig an die
Pinnwand bzw. ans Flipchart und tragen Sie Ihre Bewertungen für jeden
Vorschlag ein.“
Wählen Sie die Lösungsidee aus, die den höchsten Zuspruch erhalten hat.
Konkretisieren Sie die erste Lösungsidee
Beispiel für die Anmoderation:
„Wie ist die erste Lösungsidee zu verstehen? Handelt es sich um eine tragfähige
erste Teillösung für unsere Verhandlung, die wesentlichen Interessen Rechnung
trägt und realisierbar ist?
Jede Lösungsidee sollte so formuliert sein, dass sie die SMART-Kriterien erfüllt:
• Specific: Treffen Sie klare und präzise Regelungen!
• Measurable: Achten Sie auf die Nachprüfbarkeit der Erfüllung getroffener
Vereinbarungen!
• Achievable: Vereinbaren Sie nur Erreichbares!
• Realistic: Achten Sie auf die Umsetzbarkeit und Realitätsnähe der getroffenen
Regelungen!
• Timed: Formulieren Sie klare Zeitpläne/ Meilensteine für die Umsetzung!
Nur wenn sich alle Parteien mit ihren Interessen im Lösungsansatz wiederfinden,
wird sich eine tragfähige Teillösung ergeben, auf die alle Parteien sich einigen
können.
Wie gut dient der Vorschlag den Interessen der Beteiligten? Welche
Interessen werden in welchem Maße durch den Lösungsansatz befriedigt?
Begründen Sie den Nutzen bzw. die Vorteile, die mit dem Lösungsansatz
verbunden sind.
Woran erkennen Sie, dass der Lösungsansatz erfolgreich war? (Zielsetzung)
Wie sehen die ersten Umsetzungsschritte aus? Durch wen? Bis wann?
Welche möglichen Hindernisse bzw. Risiken könnten die Umsetzung
gefährden?
Wie kann man die Zielerreichung durch flankierende Maßnahmen trotzdem
sicherstellen? Sind Sie überzeugt, dass das Ziel realisierbar ist, wenn die
flankierenden Maßnahmen umgesetzt werden?
Welche Vereinbarungen werden getroffen, um bei Soll-/ Ist-Abweichungen
den Erfolg nachhaltig sicherzustellen?
Welche Fragen sind noch offen? Was sollte bis zu einer endgültigen
Entscheidung noch geklärt werden?
Am Ende sollten die Lösungsschritte so konkretisiert sein, dass sich
realisierbare Handlungsschritte für die Parteien ergeben und so ein
konkreter Maßnahmenplan entsteht.“
Hinweis: Konkretisieren Sie in gleicher Weise weitere Lösungsansätze, die aus der Sicht der Parteien attraktiv erscheinen.
Nach der Konkretisierungsphase...
Beispiel für die Anmoderation:
„Wir haben jetzt alle interessanten Optionen näher betrachtet. Einige Fragen
müssen noch geklärt werden. In einer abschließenden 5.Phase werden wir
aus der Gesamtschau der Optionen heraus endgültige Vereinbarungen
treffen.
Sind bis zur Abschlussphase noch offene Fragen zu klären? Brauchen Sie
noch Zeit, um ggf. Rechtsfragen zu klären oder sich mit offenen inhaltlichen
Themen auseinanderzusetzen. Müssen Sie sich ggf. mit Gremien abstimmen?
Prüfen Sie ggf. auch die Nichteinigungsalternativen. Eine Verhandlung ist
ein Erfolg, wenn das Verhandlungsergebnis besser ist als die beste
Alternative, die Sie außerhalb der jeweiligen Verhandlung erreichen können.
Lösungen sollten stets mit der besten Alternative zur Einigung verglichen
werden, um zu sehen, ob diese Ihren Interessen mehr dient. Jeder
Konfliktbeteiligte steht während der Verhandlung irgendwann vor der Frage,
ob er einem denkbaren Einigungsvorschlag zustimmen oder diesen ablehnen
soll.
Die Entscheidung kann man nur dann begründet treffen, wenn man sich über
die eigenen Nichteinigungsalternativen Rechenschaft ablegt: „Was tue ich,
wenn die Verhandlung scheitert?“
Das Harvard-Konzept fordert: „Entwickeln Sie die beste Alternative zur
Verhandlungsübereinkunft! (BATNA)“
Überprüfen Sie den Realitätsgehalt möglicher Alternativen. Hüten Sie sich
vor überoptimistischen Einschätzungen von Alternativen.
Ein Beispiel für Überoptimismus: Vielleicht liebäugeln Sie mit der
Alternative, den Konflikt nicht im Verhandlungswege, sondern gerichtlich
entscheiden zu lassen. Befragt man Rechtsanwälte nach den
Prozessaussichten der von ihnen vertretenen Parteien, so ergeben sich
regelmäßig Wahrscheinlichkeiten, die sich zu mehr als 100% addieren (meist
140-160%).“
„Gibt es noch offene Fragen? Können wir damit die 4.Phase abschließen?“
Zu Teil 7: Phase5: Abschlussvereinbarung und Nachbetrachtung
© Prof.Dr.Merk
Kontakt: merk@t-pu.de